Aufsätze IV: Miscellen
 Wozu das alles?
Wozu das alles?
Die Frage nach dem »Wozu?« der Philosophie, ihrem Zweck also, scheint in hohem Grade unangemessen zu sein.
Stellt diese Frage nach dem Nutzen die Philosophie doch in einen Verwertungszusammenhang,
den diese eher beleuchten denn bloß bedenkenlos erfüllen sollte.
Wäre doch wenigstens nach dem Sinn des Philosophierens gefragt worden!
In: Der blaue Reiter – Journal für Philosophie 14 (2008) Nr. 25, S. 99
Der weise Mensch (Teile I-V)
Fünf mehrseitige Kolumnen mit Foto zu den technosophisch ausgelegten Themen Zeitherstellung mit Uhren,
Medienwirklichkeiten, Risikohandeln, Prothesentechnik und Wirtschaftsreligion.
In: Der blaue Reiter – Journal für Philosophie 1-3 (1995/96/97) Nr. 1-5
I. Die Zeichen der Zeit
Noch immer gibt es Menschen, die wissen wollen, was das denn sei, die
Philosophie. 'Liebe zur Weisheit' lautet die wörtliche Übersetzung. Das klingt nach einem hehren Programm.
o
so
viel
sophie
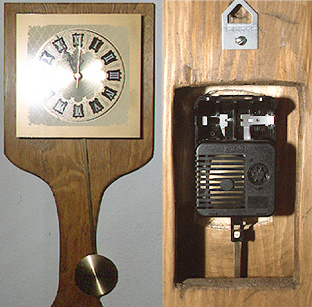
dichtet denn auch Ernst Jandl.
Doch, Anstrengung hin oder her, wie, so fragt der Zeitgenosse ungeduldig, wird mensch denn, ja, wird er selbst denn weise …?
Ob es da nicht einen Schnellkurs gebe …? Orientierung in unserer Welt tut not – hat da nicht auch einmal irgendein Philosoph von
der 'Neuen Unübersichtlichkeit' gesprochen?! Nun: den Kursus gibt es!
Lügenuhr erster Art:
Die Nostalgieuhr – eine Quarzuhr, die zudem ein Pendel elektrisch antreibt –
High-tech im archaischen Gewande.
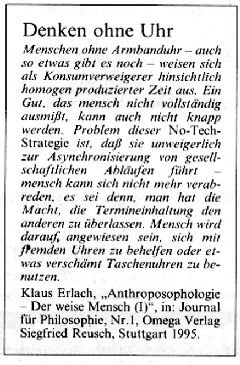
Was denn die Philosophie sei – dieser Frage wollen wir hier im ersten Teil nachgehen. Wie in der Technik, so führt auch hier, wie sich gleich zeigen wird, der Umweg schneller zum Ziel. … Der werte Leser erwägt nämlich möglicherweise gerade, ob er noch die Zeit hat, hier weiterzulesen. Schließlich könnte er ja auch noch anderes tun. Wenn nun jemand philosophiert, gerät er unter den nicht leicht abzuweisenden Verdacht, daß er denke. Und das braucht vor allem eines: Zeit. Muße. … Zeit, die nicht anderweitig zum Einsammeln von 'Welt' genutzt werden kann. Muße, die mühsam erwirtschaftete Zeitersparnisse wieder auffrißt. Die vorgängige Frage des philosophisch Interessierten lautet daher zunächst und zumeist: 'Wann ist Philosophie?'. Dieser Frage ist hier also eigentlich nachzugehen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31.Mai 1995
II. Virtuelle Welten
Was wäre das
für eine Welt
wenn die Wirklichkeit
diese Wirklichkeit rund um uns
auch die Wahrheit wäre?
– so umreißt Erich Fried dichterisch das Programm dieser Unterrichtseinheit.
Wir müssen demnach einer dreifaltigen Fragestellung nachgehen, nämlich jener, die zu klären sich anstrengt, was denn nun
das Wahre, Wirkliche und als Welt Erscheinende sei.
Fragen wir zunächst den Wissenschaftler. Er interessiert
sich dafür, welche Aussagen wahr sind oder besser – es ist ein offenes Geheimnis – unter welchen Versuchsbedingungen seine
Aussagen wahr gemacht werden können. In der Fabrikation von Erkenntnis zeigt sich der Wissenschaftler als ein
abgebrühter Techniker insofern, als er aufs Machbare abzielt. Bei der Herstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen ist
es gleichgültig, ob die wissenschaftlichen Sätze auf eine dahinter- bzw. zugrundeliegende [transzendente] Wahrheit
verweisen oder nicht. Nicht zuletzt deshalb ist in der Naturwissenschaft die Vergangenheitsform der Wahrheit immer der
Irrtum; wahre wissenschaftliche Aussagen zu machen heißt mithin – Nietzsche
sagt es uns – nach einer festen Konvention zu irren.
III. Riskante Technologien
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch
versichert Friedrich Hölderlin dem zögernden und angeblich in seinen Werten verunsicherten Zeitgenossen.
Dieser fragt sich in seiner durchaus verantwortungsbewußten Verantwortungsscheu, wie sich denn sein Können und Wollen
mit einem verantwortbaren Dürfen und Sollen vereinbaren lasse. Genügt es, sich als moralischer Warnschild-Bürger zu
gefallen und seine Verantwortung darin zu sehen, die der anderen einzuklagen?
"Der Krieg ist der Vater aller Dinge" – so formuliert der philosophische Urvater Heraklit die Einsicht,
daß im Widerstreit von Gefahr und Chance das unvermeidlich Riskante jeder Handlung gegeben ist.
Die Angst, daß das einzige Leben, das mensch zur Verfügung hat, durch einen Zufall in seiner Planung haltlos
durcheinandergebracht wird, fordert nach Sicherheiten zur Gefahrenbegrenzung. Diese bedingen jedoch einerseits
Abhängigkeiten und bergen andererseits ihre eigenen Risiken, da mensch auf das Versagen von Sicherheiten am
allerwenigsten vorbereitet ist. Während die Lobredner der Risikobereitschaft ihr Schäfchen meist schon längst ins
Trockene gebracht haben, erfordert es insbesondere das Ideal einer lückenlosen Zukunftsabsicherung häufig, Opfer und
große Risiken in der Gegenwart einzugehen. Das Ziel einer Versorgungssicherheit mit Elektrizität rechtfertigt so
tollkühnes Hantieren mit katastrophenträchtigen Anlagen. So verstärkt sich das Sicherheitsstreben zu einem destruktiven
Ideal, anstatt daß die ohnehin bestehenden Unsicherheiten als solche hingenommen werden könnten.
Obwohl bekannt ist, daß riskante Technologien vom Menschen gemacht sind, wird ihre Verwendung zumeist als Sachzwang
erlebt, so daß eine Bewertung müßig wird. Die Risikokommunikation wandelt sich dann zu einem geheimnisvollen Ritual,
das in einem Diskursverfahren mit den 'gesellschaftlich relevanten Gruppen' die nicht beseitigbaren Gefahren bewältigen
soll. So kann Geborgenheit, die die Sicherheitstechnik nicht verbürgen kann, simuliert werden.
Licht war. Rettung.
Paul Celan
IV. Kritik der maschinalen Anthropologie
Mein Körper ist voll Unvernunft,
ist gierig, faul und geil.
Tagtäglich geht er mehr kaputt,
ich mach ihn wieder heil.
So skizziert Robert Gernhardt die Forderung an eine vom Körper abgespaltete
Vernunft, beizeiten für eine Reparatur der von ihr genutzten Gerätschaft zu sorgen. Das denkende Subjekt bedient sich
demnach seiner Organe, wie der Mensch im Alltag Werkzeuge benutzt. Der Körperapparat neigt jedoch, wegen allerlei
Widerständen rauschhafter Besessenheit, instinktreduzierter Trägheit und mißratener Erotik zur Fehlerhaftigkeit und
bedarf daher fortschrittlicher Verbesserung. Diese Zielsetzung hat den Menschen folgerichtig mittlerweile ins Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit versetzt.
Die Mechanik seiner Entstehung, Funktion und Entwicklung ist dem Menschen jedoch nicht so ohne weiteres faßbar.
Für La Mettrie bedeutet menschliches Leben, eine empfindende Maschine
zu sein, die Gut von Böse unterscheidet wie Blau von Gelb. Wie eine Uhr, deren Triebfedern sich gegenseitig immer wieder
von selbst aufziehen, zeigen demnach die Menschen Bewegungen ihres Herzens und Geistes an. Die Haupttriebfeder des Denkens
im Gehirn bringt – entsprechend erregt – das Blut in Wallung. Weil diese fantasiebegabte Uhr jedoch nicht an die üblichen
Gesetze der Mechanik gebunden ist, kann mann sich kein theoretisches Modell von ihr machen. Die Irrwege einer trotzdem
unternommenen maschinalen Anthropologie sind in diesem Kurs nachzuzeichnen.
<
Einen schlaffen Eindruck vermittelt ein jeder Esel,
wenn ihm seine Spannkräfte, die ihn zusammenhalten und aufrichten,
von leitender Stelle entzogen werden.
 Die Räderwerke der Uhren und die Zahnräder der Maschinen entsprechen keinem natürlichen Bewegungsablauf. Deshalb ist die
Grazie einer vollendeten und ebenmäßigen technischen Bewegung nur im Tanz der Marionette aufzufinden. Diese weist nach
Heinrich Kleist zudem eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte als der
Mensch auf. Während letzterer sich ziere, da sein Bewußtsein den körperlichen Schwerpunkt immer wieder verlasse, folgen
die Glieder der Marionette wie Pendel dem bloßen Gesetz der Schwere nach mechanischen Gesetzen von selbst. Bei ihren
Pirouetten brauchen die von den Fäden gehaltenen Puppen ferner den Boden nur, um ihn, wie die Elfen, zu streifen, nicht
aber um darauf, wie der Mensch, zu ruhen. Diese beiden Merkmale der Marionette erweisen sich als Sinnbild einer
optimalen Prothesensteuerung. Die Fäden zur Durchsetzung äußerer Zwänge einerseits zeigt
Charly Chaplin in den Modernen Zeiten. Den mechanischen Gliederaufbau als
Indiz eines eingeprägten maschinenhaften Verhaltens andererseits zeichnet der Regisseur
Wolfgang Staudte durch Darstellung der gedankenlosen Verbindung von Befehl
und Ausführung im Untertan nach. Mit einer so vollstreckten zweifachen Maschinenwerdung geht mensch – als Folge
der Disziplinierung des Körpers durch das Dreigespann Überwachen, Strafen und Prüfen – jeglichen Empfindens seiner
Leiblichkeit verlustig.
Die Räderwerke der Uhren und die Zahnräder der Maschinen entsprechen keinem natürlichen Bewegungsablauf. Deshalb ist die
Grazie einer vollendeten und ebenmäßigen technischen Bewegung nur im Tanz der Marionette aufzufinden. Diese weist nach
Heinrich Kleist zudem eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte als der
Mensch auf. Während letzterer sich ziere, da sein Bewußtsein den körperlichen Schwerpunkt immer wieder verlasse, folgen
die Glieder der Marionette wie Pendel dem bloßen Gesetz der Schwere nach mechanischen Gesetzen von selbst. Bei ihren
Pirouetten brauchen die von den Fäden gehaltenen Puppen ferner den Boden nur, um ihn, wie die Elfen, zu streifen, nicht
aber um darauf, wie der Mensch, zu ruhen. Diese beiden Merkmale der Marionette erweisen sich als Sinnbild einer
optimalen Prothesensteuerung. Die Fäden zur Durchsetzung äußerer Zwänge einerseits zeigt
Charly Chaplin in den Modernen Zeiten. Den mechanischen Gliederaufbau als
Indiz eines eingeprägten maschinenhaften Verhaltens andererseits zeichnet der Regisseur
Wolfgang Staudte durch Darstellung der gedankenlosen Verbindung von Befehl
und Ausführung im Untertan nach. Mit einer so vollstreckten zweifachen Maschinenwerdung geht mensch – als Folge
der Disziplinierung des Körpers durch das Dreigespann Überwachen, Strafen und Prüfen – jeglichen Empfindens seiner
Leiblichkeit verlustig.
V. Der Prothesengott
Kapital unser, das du bist im Westen –
Amortisieret werde deine Investition –
Dein Profit komme –
ER sprach: Es werde Licht! –
Jedoch: Im Anfang war die Tat!
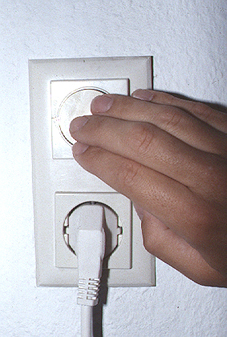 so schließt Reinhold Oberlercher das Evangelium des freien Marktes in seine
Fürbitte ein. Dieser monetäre Erlösungsglaube moderner Industriereligion gründet sich auf die wohltätige Führung der
'unsichtbaren Hand' des Marktes. Die Industrie lebt jedoch nicht vom Geld allein, sondern bedient sich vielfältiger
Apparaturen und Anlagen. Ein effizienter und profitabler Einsatz der Geräte ist nur bei strikter Befolgung der nach den
Gebrauchsanweisungen zulässigen Bedienungsabläufe möglich, weil die Maschinenfunktionen auf den Naturgesetzen basieren.
Den Glauben an die Existenz dieser absolut geltenden Gesetze zu leugnen, hieße, sich der Ketzerei am wahren
Wissenschaftsglauben (Szientismus) schuldig zu machen.
so schließt Reinhold Oberlercher das Evangelium des freien Marktes in seine
Fürbitte ein. Dieser monetäre Erlösungsglaube moderner Industriereligion gründet sich auf die wohltätige Führung der
'unsichtbaren Hand' des Marktes. Die Industrie lebt jedoch nicht vom Geld allein, sondern bedient sich vielfältiger
Apparaturen und Anlagen. Ein effizienter und profitabler Einsatz der Geräte ist nur bei strikter Befolgung der nach den
Gebrauchsanweisungen zulässigen Bedienungsabläufe möglich, weil die Maschinenfunktionen auf den Naturgesetzen basieren.
Den Glauben an die Existenz dieser absolut geltenden Gesetze zu leugnen, hieße, sich der Ketzerei am wahren
Wissenschaftsglauben (Szientismus) schuldig zu machen.Wenn ein technisches Gerät einmal nicht funktioniert, so ist damit nicht der Glaube an wissenschaftliche Wahrheiten widerlegt, sondern ein jeder ist zutiefst davon überzeugt, daß der Apparat 'kaputt' sein muß. Das verehrende Tier jedoch vertraut blindlings auf seine existentielle Sicherung dank der sonst mit bewährter Verläßlichkeit funktionierenden Techniken. Doch angesichts des Religionskrieges um die sterblichen Überreste energetischen Götzendienstes gilt es, das erlösende Heil mit der magischen Kraft neuer Geräte zu verwirklichen. Nur ein Prothesen-Gott kann uns retten!
Mammon.
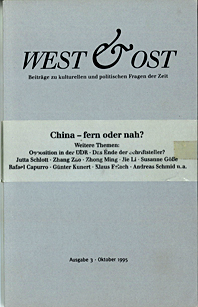 Von Mao zu High-Tech.
Von Mao zu High-Tech.
China als Modernisierungsprojekt
Erfahrungsbericht eines Forschungsaufenthaltes im frühkapitalistischen China.
Ein Gespenst geht um in China – das Schreckgespenst des bürgerlichen Liberalismus. Gegen Ende der siebziger Jahre haben sich die Mächtigen in der Kommunistischen Partei verbündet, um dem ihr anvertrauten Reich Modernisierungen in den vier Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Militär sowie Wissenschaft und Technologie zu verordnen.
Doch fehlt da nicht noch etwas? Wo ist die „Fünfte Modernisierung“, die auf einen gesellschaftspolitischen Bereich Bezug nehmen würde – beispielsweise auf das Rechtssystem, die Verfassung oder gar die zukünftige Rolle des (autonomen) Individuums. Gerade in einem Land, das sich in der Vergangenheit ausgiebigst mit Veränderungen der Gesellschaftsstruktur beschäftigt hat, erwartet man eigentlich auch ein Modernisierungskonzept, das sich auf den „Überbau“ bezieht.
Zweierlei geht aus dieser Leerstelle – diesem Schweigen zur Demokratisierung – hervor.
Gegen die Modernisierung erheben sich Widerstände. Sehr einfach hatte es da einst die Kaiserinwitwe Cixi, die die Modernisierung in persona namens Guangxu in einem Tempel auf dem Gelände des Sommerpalastes in Beijing einmauern ließ. Mit ähnlicher Absicht stellt der Ideologe Li Honglin fest, daß die „dekadente und degenerierte Ideologie des Westens“ die Luft genauso kontaminieren wird, wie dies die in unschuldiger Modernisierungsabsicht transferierte Technik bereits heute tut. In despkriptiver Hinsicht ist dem durchaus zuzustimmen.
Es ist daher an der Zeit, das von den Pragmatikern vorangetriebene Modernisierungskonzept mit seinen operativen Mitteln,
strategischen Kennzeichen und sozioökonomischen Auswirkungen angesichts der wachsenden weltwirtschaftlichen Verflechtungen und
Abhängigkeiten zu entfalten und der Angst vor dem bürgerlichen Liberalismus – häufig verbunden mit dem Fantasma eines im Chaos
zerfallenden Reiches – einen Bericht vom sich entwickelnden Laisser-faire-Kapitalismus konfuzianischer Prägung entgegenzustellen.
In: West & Ost 1 (1995) 3, S.59-66
 Interdisziplinäre Blüten in der Forschungslandschaft.
Interdisziplinäre Blüten in der Forschungslandschaft.
Ein wissenschaftstheoretisches Schaustück in drei Akten
1. Akt, 1. Aufzug: Die disziplinäre Wirklichkeit in ihrer Vielheit
Erfolgsgeheimnis der Wissenschaft ist ihre gnadenlose Analyse, die es erlaubt, eine Kleinigkeit ganz genau zu wissen.
Nicht umsonst vergleicht Bacon das Experiment mit der Inquisition. Mit der Glorifizierung des Details muß jedoch ein
dreifacher Preis entrichtet werden. Dies ist zunächst die Abblendung des Kontextes, aus dem der jeweilige
Gegenstand der Forschung herausgerissen wird, damit man ihn als eine umgrenzte Einheit untersuchen kann. Zweitens bewirkt
die Begrifflichkeit eine Vorformung des Erkenntnisgegenstandes. Und drittens erzeugt die große Anzahl
wissenschaftlicher Methoden eine Vielfalt wissenschaftlicher Ansichten vom lebensweltlich gleichen Phänomen.
Aus dem letztgenannten disziplinbildenden Prinzip heraus bringt die Wissenschaft gegeneinander isolierte Kunstwelten
hervor: tausend disziplinäre Augen blicken auf die Welt.
1. Akt, 2. Aufzug: Die Utopie der Einheitswissenschaft
Das Kollektiv von Einäugigen erzeugt ein unbefriedigendes, weil widersprüchliches und unvollständiges Bild von der
Wirklichkeit. Diese Mängel fordern ihre Beseitigung geradezu heraus. Als umfassenste und zugleich radikalste Lösung bietet
sich hier der vereinheitlichende Blick einer Universalwissenschaft an. Gesucht ist dieses Einheitsauge, das dem
je einzelnen Bewußtsein eine wahre Gesamtschau der auf vielfältige Weise wandelbaren Welt vermittelt.
2. Akt: Der interdisziplinäre Dialog
Wenn auch die Aufsplitterung der Forschung Ergebnis der wissenschaftlichen Welterschließung durch Spezialisierung ist,
so ist die damit einhergehende Unübersichtlichkeit als solche nicht angestrebt. Als geeignetes Instrument bietet sich daher
eine wenigstens vielfältige, also multidisziplinäre Herangehensweise an. Der Dialog zwischen den Disziplinen kann auf den drei Ebenen
des Begriffstransfers, des Ideentransfers bis hin zur systematischen Modellübertragung und des Methodentransfers geführt werden.
Zur eigentlichen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern mehrerer Disziplinen kommt es mit dem interdisziplinären Dialog,
in dem die aus unterschiedlichen Perspektiven gewonnenen Ansichten von der Welt einander gegenübergestellt werden.
3. Akt: Die Realisation
Der Grenzwert moderner Spezialisierung liegt in der Zerlegung der Wissenschaft in so viele (Teil-)Disziplinen,
wie es Wissenschaftler gibt. Um diesem Grenzfall auszuweichen, richtet sich die Wissenschaft den interdisziplinären Dialog
ein. Da dieser auch wissenschaftlichen Kriterien genügen soll, kommt es zum selbstreferentiellen Paradoxon
der Anwendung der Disziplinierung auf Disziplingrenzen und -zwischenräume mit dem Ergebnis einer
'interdisziplinären Disziplin', die entweder Transferleistungen formalisiert (Modellübertragung) oder bestimmte
Phänomene wiederum als eigenständige Disziplin betrachtet. Den tausend Augen bisheriger Wissenschaft wird so ein weiteres 'transgenetisches' hinzugefügt.
In: Der blaue Reiter Journal für Philosophie 1 (1995) 1, S.55-60